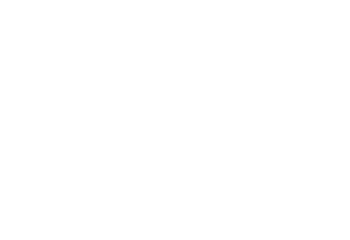Arbeiten in Spannungsverhältnissen 4:
Ausschlüsse durch offene Lernformen
«Somit werden bestimmte Betrachtungsweisen von Kunst […] stillschweigend vorausgesetzt und bei denen, die sie bereits innehaben, unbewusst wiedererkannt und lobend gefördert. Die Weitergabe des Wissens, das zum Verständnis oft notwendig ist, sowie die Weitergabe der Mittel und Techniken, dieses zu erwerben, bleiben dabei oft ausgespart, und diejenigen, die es nicht bereits unbewusst besitzen und gerade deshalb zumeist auch nicht danach zu fragen wagen, werden im pädagogischen Prozess benachteiligt.» (Sternfeld 2005)
Die Lernpsychologie der Gegenwart definiert Lernen als Veränderung und Aneignung von Verhaltensweisen und Einstellungen durch Erfahrung und/oder Üben. Dieser Lernbegriff geht über die Alltagsvorstellung von schulischer Instruktion und der gezielten Vermittlung von Inhalten hinaus. Jede dauerhafte Verhaltens- und Einstellungsänderung wird als lernbasiert verstanden, wenn sie nicht auf physische Alterung, Krankheit und Ähnliches zurückzuführen ist: «Hier sprechen wir auch vom Lernen von Angst und Sicherheit, vom Erwerb von Vorlieben und Abneigungen, der Ausbildung von Gewohnheiten, der Befähigung von planvollem Handeln und problemlösendem Denken» (Edelmann 1993, S.5).
Das gegenwärtig vorherrschende Verständnis von Lernprozessen fusst auf konstruktivistischen Lerntheorien (Reich 2006; Harms, Krombass 2008). Diesen zufolge ist Lernen weniger ein Resultat von Instruktion als ein selbstgesteuerter Prozess von Sinnkonstruktion. Erwerb von Wissen und Können ist demnach unauflöslich verknüpft mit dem Herstellen von Bedeutung. Dieser Prozess ist zirkulär und basiert auf aktivem Handeln: Konkrete Erfahrung führt zu Reflexion und dem Entwickeln abstrakter Konzepte. Die Anwendung der Konzepte generiert wiederum Erfahrung, wodurch der Zirkel von neuem beginnt (Kolb, Fry 1975).1 Dies geschieht sowohl individuell als auch durch Interaktionen (ko-konstruktivistisches Lernen). Soziale Beziehungen und Emotionen sind dabei wichtige Faktoren für den Lernprozess. Die Lernforscher_innen John Howard Falk und Lynn Dierking verstehen das Lernen als Dialog mit der Umwelt mit dem Ziel der Orientierung. Dieser Dialog ist durch das Zusammenwirken von persönlichen, soziokulturellen und physischen Kontexten sowie von seiner jeweiligen Zeitlichkeit geprägt (kontextuelles Lernen). Lernen, Wissen und Erfahrung sind demzufolge stets ortsgebunden, das heisst situiert. Ergebnisse von Lernprozessen sind davon abhängig, unter welchen Umständen und Voraussetzungen sie stattfinden. Aus dieser Perspektive gewinnt das Schaffen von Umgebungen, die vielschichtige Erfahrungen und Verknüpfungen ermöglichen, gegenüber der Frage, welche Inhalte vermittelt werden sollen, an Gewicht. Auch wird das Wissen, welches von den Lernenden in eine Situation eingebracht wird, genauso als relevant gewertet wie dasjenige, welches die Lehrenden zur Vermittlung vorgesehen haben. Die Lernsituation sollte demzufolge aus konstruktivistischer Perspektive auf Mitbestimmung und Beteiligung fussen. Die Lehrenden verstehen sich eher als Begleitende denn als Instrukteur_innen und sind zudem selbst immer auch Lernende. Unscharf werden auch die Kriterien für «richtig» oder «falsch» – verfehlte Ziele und unvorhergesehene Ergebnisse werden nicht als negativ oder überflüssig gewertet, sondern als Erfahrungen, die wiederum zu neuen Lernbewegungen führen (Spychiger 2008).
Der Kulturvermittlung, ihren Akteuren, Orten und Inhalten werden bei diesem Zugang zum Lernen besondere Potentiale zugesprochen. Falk und Dierking beispielsweise identifizieren das Museum als einen idealen Ort für offene, auf Selbststeuerung, Exploration und Eigentätigkeit setzende Lernarrangements (Falk, Dierking 2000). Der Psychologe Howard Gardner, Autor des im Feld der Kulturvermittlung einflussreichen Konzepts der multiplen Intelligenzen (Gardner 2002), sieht in der Beschäftigung mit Kunst die Möglichkeit, unterschiedliche Lerntypen über die sprachliche und mathematische Intelligenz hinaus zu fördern (siehe auch das → Project Zero an der Harvard University, in dem seit 1967 das Lernen in den Künsten untersucht wird). In jüngerer Zeit sind Studien zu Handlungslogik und Selbstverständnis von Künstler_innen, die in der Vermittlung arbeiten, entstanden (→ Pringle 2002; → Pringle 2009). Diese belegen Korrespondenzen zwischen einem konstruktivistischen Lernverständnis und den Haltungen und Vorgehensweisen in der zeitgenössischen künstlerischen Produktion. Künstler_innen arbeiten als «reflexive Praktiker_innen» (Schoen 1983) erfahrungsbasiert in tentativer, explorativer Weise. Ihre Arbeit hat heutzutage selten einen Universalanspruch, sondern versteht sich in der Regel situiert und kontextabhängig, hinterfragt scheinbar feststehende Vorstellungen von richtig und falsch und begreift Scheitern und das sich Ereignen von Unvorhergesehenem als produktiven Vorgang, zuweilen auch als Bedingung für den Schaffensprozess (Schmücker 2003). Die beiden Künstlerinnen Seraphina Lenz und Stella Geppert versuchen in einem Text von 2006 basierend auf ihren Erfahrungen in einem Modellprojekt zur künstlerischen Vermittlungsarbeit die Unterschiede zwischen künstlerischem und schulischem Lernen zu systematisieren (Geppert, Lenz 2006):2
Ein künstlerischer Prozess
- Ein künstlerischer Prozess verläuft eigenständig und selbst motiviert.
- Künstlerische Prozesse können die Qualität von Erforschung haben und beinhalten daher Umwege und Sackgassen. Ein vorher definiertes Ziel kann meistens nicht linear angestrebt werden.
- Künstlerische Prozesse beinhalten eigene, dem Prozess angemessene Zeitstrukturen.
- Künstlerische Prozesse erfordern Kommunikation mit sich selbst und anderen sowie Sensibilität in der Fremd- und Selbstwahrnehmung.
Lernprozesse im Kunstunterricht
- Lernprozesse im Kunstunterricht werden vom Lehrer initiiert.
- Die in der Schule vorgegebene Struktur erfordert einen ökonomischen Umgang mit Zeit.
- Die Verantwortung für den Lernprozess hat der Lehrer. Er liefert die Idee, das Material, das Knowhow und den zeitlichen Rahmen.
- Die Rückmeldung hinsichtlich der Arbeit erfolgt als Bewertung durch den Lehrer in Form von Noten.
Gegenüberstellungen wie diese sind sehr anschaulich, funktionieren allerdings nur um den Preis massiver inhaltlicher Reduktionen. So könnte man auf die ökonomischen und zeitlichen Zwänge künstlerischer Projektarbeit verweisen und demgegenüber die Langfristigkeit und Kontinuität schulischen Lernens als förderlicher für die Initiierung von offenen Suchprozessen benennen. Umgekehrt muss festgestellt werden, dass auch in der Schule Projektunterricht und «selbstorganisiertes Lernen» zum Repertoire, inzwischen zuweilen sogar zu den vorgeschriebenen Formaten und Methoden gehören (→ Patzner et al. 2008). Auch zu behaupten, die künstlerische Arbeit sensibilisiere zwangsläufig die Selbst- und Fremdwahrnehmung, erscheint mit Blick auf die harten Selektionsmechanismen, den Selbstbehauptungs- und Profilierungsdruck und die Konkurrenz im künstlerischen Feld romantisierend. Weiter kann der Umgang mit den Lernenden seitens von Künstler_innen mit einer starken Produktorientierung potentiell rigider sein als der einer Lehrperson mit einer entsprechenden Prozessorientierung. Es kommt also womöglich weniger auf den beruflichen Hintergrund als vor allem auf eine am «Künstlerischen» orientierte Haltung (im Sinne von Pringle, s.o.) an, mit der Lernsituationen gestaltet werden. Dies hat auch die Erziehungs- und Sozialwissenschaft erkannt. Sie hat in den letzten zwanzig Jahren eine «performative Wende» erfahren, setzt zunehmend auch künstlerische Methoden ein und überprüft diese auf ihre Potentiale für pädagogisches Handeln (→ Mackenzie 2011; Springay 2007; → Wulf, Zirfas 2007, S.7 ff.). Umgekehrt ereignet sich ein «Educational Turn» in den Künsten: Es mehren sich interdisziplinäre Projekte, die mit pädagogischen Methoden arbeiten, Bedingungen der Wissensproduktion mit künstlerischen Mitteln analysieren und dabei mit unterschiedlichsten Gruppen und Individuen als Teilnehmenden interagieren (→ Podesva 2007). Die Aufrechterhaltung einer starren Opposition von «Kunst» einerseits und «Lernen» andererseits erscheint angesichts dieser Überlagerungen nicht mehr angemessen. Es ist schwierig, eine klare Trennlinie zwischen Kulturvermittlung, Kunst und Bildung zu ziehen. Anschaulich hierfür ist unter anderem die Theaterpädagogik: Als Berufsfeld verfügt sie über eine eigenständige Fachgeschichte und befindet sich in permanenter Weiterentwicklung. Ihre anspruchsvolleren, zum Beispiel am → postdramatischen Theater orientierten Spielarten sind schwer oder gar nicht von Theaterkunst, die sich ihrerseits pädagogische und partizipative Verfahren aneignet, zu unterscheiden (vgl. dafür beispielsweise die Projekte der Wiener Gruppe → Wenn es soweit ist).
In einigen Fällen reagiert auch die Förderebene auf die Interferenzen von «Kulturvermittlung», «Kunst» und «Bildung». Ein Beispiel ist die Einrichtung des → Projektfonds Kulturelle Bildung des Berliner Senats im Jahr 2008, der von einer unabhängigen Stelle zwischen der Abteilung Kultur und der Abteilung für Bildung und Soziales koordiniert wird . Oder in der Schweiz die teilweise in den Erziehungsdirektionen, teilweise in den Kulturabteilungen der Kantone angesiedelten Koordinationsstellen zur Kooperation zwischen Schulen und Künstler_innen sowie Kultureinrichtungen.3 Im Zuge von Bildungskrisen und der damit einhergehenden Hinterfragung der zeitgemässen und vor allem auch inklusiven Verfasstheit von Erziehungssystemen, die unterschiedliche Lerntypen berücksichtigen, erscheint die Bildung mit und über die Künste aufgrund der oben beschriebenen Potentiale immer wieder als Hoffnungsträgerin. Die → Freien Kunstschulen in Deutschland zum Beispiel entstanden als Reaktion auf die in den 1960er Jahren diagnostizierte «Bildungskatastrophe» (Picht 1964). In ihnen wurde (und wird) in allen künstlerischen Sparten – zu Beginn insbesondere auch im Bereich Tanz, Musik und Theater – ausserschulisches, nicht zertifiziertes, «freies» Arbeiten für Kinder und Jugendliche offeriert . Eine ihrer wichtigsten Begründungen war die Kritik an einer zu wenig künstlerischen Ausrichtung, an überhöhtem Leistungsdruck und mangelnder Gelegenheit zu «Selbstentfaltung und eigenschöpferischer Tätigkeit» in der Regelschule, die durch die Kunstschulen kompensiert werden müssten (Erhart et al. 1980, S.15). Nun wäre zu vermuten, dass Angebote, die sich dezidiert als «frei» bezeichnen und der persönlichen Entfaltung dienen, eine hohe Attraktivität für sehr verschiedene Nutzer_innen aufweisen. Tatsächlich aber ist es (nicht nur) den freien Kunstschulen nie wirklich gelungen, ihren selbst gesetzten Anspruch, über alle Schichten und Altersgrenzen hinweg offen zu sein, konsequent einzulösen. In aller Regel werden ihre Angebote von Angehörigen der Mittelschicht genutzt. Diesem Widerspruch widmete sich bereits 1980 eine Studie (Kathen 1980). Am Beispiel des Stadtteils Unna Königsborn im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen werden darin Verdrängungskämpfe und widerstreitende Interessen bei der Gründung einer Kunstschule aufgezeigt. Jugendliche, die ihre Freizeit bis dato grösstenteils auf den Strassen des Stadtteils verbracht hatten und Kulturarbeiter_innen renovierten dort zunächst zusammen ein Haus, um eine freie Kunstschule einzurichten. Doch nach diesem gemeinsamen Aneignungsprozess kam es zum Streit. Die Vorstellungen der Kursleiter_innen über künstlerische Bildung erwiesen sich als nicht vereinbar mit den Interessen der Jugendlichen. Es kam zur Schliessung des Hauses und zu öffentlichen Protesten seitens der Jugendlichen. Als involvierte Dozentin unternimmt die Autorin der Studie die Aufarbeitung dieser konfliktreichen Erfahrung und kontextualisiert sie in einer Untersuchung von zwölf weiteren Kunstschulen. Sie kommt zu einem äusserst kritischen Ergebnis: Die Arbeit in den Jugendkunstschulen fusse auf den elitären Konzepten des bürgerlichen Kulturbegriffs, anstatt Alternativen dazu zu entwickeln. Die Einrichtungen produzierten Ausschlüsse, weil die Angebotsstruktur nicht dazu geeignet sei, Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Schichten zu interessieren. Diese fast schon historische Studie hat kaum etwas von ihrer Aktualität verloren. Gegenwärtig mehren sich die Einsprüche gegen eine vorbehaltlos positive Bewertung von offenen Lernformen und «selbstgesteuertem Lernen», die für eine partizipativ ausgerichtete Kulturvermittlung charakteristisch sind und gerade als deren Potential beschrieben werden. So macht der Erziehungswissenschafter Michael Sertl deutlich, dass diese Lernformen auf Erziehungspraktiken der Mittelschicht basieren. Sie bauen auf bei Mittelschichtskindern bereits im Elternhaus ausgebildete Fähigkeiten, Sprach- und Verhaltenscodes auf, werden daher besonders von diesen angenommen und nützen vor allem deren «Selbstentfaltung» (→ Sertl 2007, S.2). Zu postulieren, sie seien gewinnbringend für alle, bedeutet wiederum, die Lebens- und Lernstile der Mittelschicht als Norm zu setzen, zu → naturalisieren. Während Sertl bei seinen Überlegungen vor allem die Regelschule im Blick hat, erhebt die Kunstvermittlerin und Theoretikerin Nora Sternfeld ähnliche Einsprüche bezogen auf die Kulturvermittlung (Sternfeld 2005). Sie fokussiert die in der Kulturvermittlung häufig zu findende Verknüpfung des «Aufrufs zur selbstständigen Erkundung und kreativen Selbsttätigkeit» mit der Idee der «natürlichen Begabung», die es jeweils individuell zu entfalten gelte. Dieser Zugang gilt im Arbeitsfeld der Kulturvermittlung als besonders wenig elitär (Sternfeld 2005, S.22). Mit Bezug auf Bourdieu (Bourdieu 2001) macht Sternfeld darauf aufmerksam, dass es sich aber bei «Begabung» selbst um ein gesellschaftliches Konstrukt handelt. Als «spontan», «kreativ» und «fantasievoll» gelten nachweislich Menschen, die im gebildeten Bürgertum aufgewachsen und sozialisiert sind. Demgegenüber gelten die Vermittlung von Fachwissen genauso wie das Üben von Techniken der Wissensaneignung im progressiven Teil des Arbeitsfelds der Kulturvermittlung eher als autoritär, unkreativ und wenig zeitgemäss. Es zeigt sich, dass auch die Arbeit in offenen, explorativen Lernsettings aus der Perspektive der Kulturvermittlung (auch hier wiederum vorausgesetzt, sie versteht sich als kritische Praxis und verfolgt den Anspruch von Zugangsgerechtigkeit) mit Widersprüchen behaftet ist. Einerseits liegt in der Entfaltung solcher Lernsettings das besondere Potential der Kulturvermittlung. Ihre zentralen Gegenstände, die Künste, korrespondieren mit den entsprechenden pädagogischen Methoden. Eine formalisierte Leistungsbewertung entfällt, was die Prozessorientierung und Ergebnisoffenheit potentiell befördert. Andererseits laufen diese Settings wiederum Gefahr, genau die Ausschlüsse zu produzieren, gegen die zu arbeiten eine der zentralen Legitimationen und Selbstverpflichtungen von Kulturvermittlung darstellt. Eine Antwort auf die Frage nach dem Umgang mit diesem Widerspruch findet sich schon in der oben erwähnten Studie Dagmar von Kathens aus dem Jahr 1980. Diese kritisiert die wenig hinterfragende Art und Weise, in der die Auseinandersetzung mit Kunst in den freien Kunstschulen stattfinde. Die Kinder und Jugendlichen würden dort in die → Liebe zur Kunst eingeübt. «Bei der Auseinandersetzung mit Kunst muss es jedoch, um für eine emanzipatorische ästhetische Erziehung von Nutzen zu sein, um eine kritische Analyse der Kunst gehen. Nicht jede künstlerische Äusserung ist automatisch positiv […]. Zu dem Umgang mit Kunst gehört die Aneignung ihrer gesellschaftlichen Funktion, die gesellschaftliche Stellung von Künstlern, ihre starke Individualisierung etc. […]» (Kathen 1980, S.155). Von Kathen schlägt also vor, die Analyse der gesellschaftlichen Funktionen von Kunst mit zum Gegenstand der Kulturvermittlung zu machen. Damit korrespondiert Sternfelds Ansatz, gerade bei der Arbeit mit marginalisierten Gruppen in der Kulturvermittlung institutionelle Ausschlüsse nicht zu verdecken und damit zu legitimieren, sondern sie anzusprechen (Sternfeld 2005, S.31). Dies ist zweifellos eine wichtige Komponente einer Kulturvermittlung als kritischer Praxis und lässt sich, insofern auf Vermittlungsseite ein Interesse und die Bereitschaft dazu bestehen, grundsätzlich in jeder Situation zumindest im Ansatz realisieren. Doch mit einer inhaltlich-verbalen Thematisierung alleine ist Ausschlüssen noch nicht entgegengewirkt. Die Kritik an offenen Lernformen ist selbst eine Sache von Privilegien. Entsprechend plädieren auch Kritiker_innen wie Sertl (Sertl 2007, S.1) nicht dafür, offene Lernformen abzuschaffen, sondern ihre Ausschlusspotentiale pädagogisch zu berücksichtigen anstatt naiv-euphorisch mit ihnen umzugehen. Im Sinne einer solchen Reflexivität müsste es in der Kulturvermittlung darum gehen, zunächst überhaupt eine skeptische Distanznahme zu den eigenen pädagogischen «Wahrheiten» zu entwickeln. Eine Ausstellungsvermittlung beispielsweise, die davon ausgeht, es sei grundsätzlich antielitär und demokratisch, Teilnehmende ihr «Lieblingsbild» aussuchen und davor «frei assoziieren» zu lassen, könnte diese Praxis darauf überprüfen, was in einer Gruppensituation in einem Museum überhaupt «frei» assoziiert und geäussert werden darf, ohne die ungeschriebenen Verhaltensregeln zu verletzen – oder wessen Assoziationen die Vermittlungsperson «interessant» findet. In allen Sparten könnten Methoden der Wissensaneignung selbst zum Gegenstand der Vermittlung werden, anstatt auf die pädagogische «Intuition» der Vermittlungsperson und allzu stark auf die Selbststeuerung der Lernenden zu setzen. Dies setzt allerdings voraus, dass die in der Kulturvermittlung tätigen Personen pädagogisch so professionell sind, dass sie in der Lage sind, ihr Methodenwissen den Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen – es also systematisch darzustellen und verbal sowie übend zugänglich zu machen.4 Sternfeld fordert weitergehend, dass sich die Vermittler_innen und letztlich die Kulturinstitutionen aktiv mit den Anliegen dieser Gruppen solidarisieren: «Das Selbstverständnis dieser Vermittlung wäre eine Öffnung der Institutionen auch für politische Praxis und Organisation» (Sternfeld 2005, S.32). Ein ernsthaftes Arbeiten gegen die institutionellen Ausschlüsse führte demnach in der Konsequenz zu einer Kulturvermittlung mit → transformativer Funktion für die Institutionen.Literatur und Links
Publizierte Beiträge, auf denen Teile dieses Textes beruhen:- Mörsch, Carmen: «Im Paradox des großen K. Zur Wirkungsgeschichte des Signifikanten Kunst in der Kunstschule», in: Mörsch, Carmen; Fett, Sabine (Hg.): Schnittstelle Kunst – Vermittlung. Zeitgenössische Arbeit in Kunstschulen, Bielefeld: Transcript, 2007
- Bourdieu, Pierre: «Die konservative Schule. Die soziale Chancenungleichheit gegenüber Schule und Kultur», in: Bourdieu, Pierre: Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, Schule und Politik, Hamburg: VSA, 2001
- Edelmann, Walter: Lernpsychologie, Weinheim: Psychologie Verlags Union, 1993
- Erhart, Kurt, et al.: Die Jugendkunstschule. Kulturpädagogik zwischen Spiel und Kunst, Regensburg: Gustav Bosse, 1980
- Falk, John Howard; Dierking, Lynn: Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning, AltaMira: Rowman & Littlefield, 2000
- Gardner, Howard: Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes, Stuttgart: Klett-Cotta, 2002
- Geppert, Stella; Lenz, Seraphina: «Ein Kreis kann nie perfekt sein», in: Maset, Pierangelo, et al. (Hg.): Corporate Difference: Formate der Kunstvermittlung, Lüneburg: Edition Hyde, 2006
- Harms, Ute; Krombass, Angela: «Lernen im Museum – das Contextual Model of Learning», in: Unterrichtswissenschaft, 36/2, 2008, S.130–166
- Kathen, Dagmar von: Möglichkeiten der ästhetischen Erziehung in der Jugendarbeit. Eine Untersuchung der Konzeption und praktischen Arbeit an Jugendkunstschulen, schriftliche Hausarbeit im Fach Kunsterziehung zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium, Düsseldorf, 1980
- Kolb, David Allen; Fry, Ronald Eugene: «Toward an applied theory of experiential learning», in: Cooper, Cary L. (Hg.): Theories of Group Process, London: John Wiley, 1975
- MacKenzie, Sarah K.: Playing Teacher: Artful Negotiations in the Pre-service Classroom, in: Forum: Qualitative Social Research/Sozialforschung, Vol. 12, Nr. 1, 2011 [21.2.2013]]; → MFV0404.pdf
- Patzner, Gerhard, et al.: «Offen und frei? Beiträge zur Diskussion Offener Lernformen», in: schulheft 130, 33. Jahrgang, Innsbruck-Wien-Bozen: StudienVerlag, 2008 [21.2.2013]; → MFV0403.pdf
- Podesva, Kristina Lee: «A Pedagogical Turn: Brief Notes on Education as Art», in: Fillip 6, Sommer 2007 [14.10.2012]; → MFV0405.pdf
- Picht, Georg: Die deutsche Bildungskatastrophe: Analyse u. Dokumentation, München: Walter, 1964
- Pringle, Emily: We did stir things up: The Role of Artists in Sites for Learning, London: Arts Council of England, 2002 [30.11.2012]; → MFV0401.pdf
- Pringle, Emily: The Artist as Educator: Examining Relationships between Art Practice and Pedagogy in the Gallery Context, London: Tate Papers, Nr. 11, 2009 [30.11.2012]; → MFV0402.pdf
- Reich, Kersten: Konstruktivistische Didaktik – ein Lehr- und Studienbuch inklusive Methodenpool auf CD, Weinheim: Beltz-Verlag, 2006
- Schoen, Donald: The Reflective Practitioner, New York: Basic Books, 1983
- Schmücker, Reinhold: «Der ‹Griff zur Kunst› – ein Kunstgriff in Bildungsprozessen?», in: Ermert, Karl, et al. (Hg.): Kunst-Griffe. Über Möglichkeiten künstlerischer Methoden in Bildungsprozessen, Wolfenbüttel: Bundesakademie für kulturelle Bildung, 2003, S.8–28
- Sertl, Michael: «Offene Lernformen bevorzugen einseitig Mittelschichtkinder! Eine Warnung im Geiste von Basil Bernstein», in: Heinrich, Martin; Prexl-Krausz, Ulrike (Hg.): Eigene Lernwege – Quo vadis? Eine Spurensuche nach «neuen Lernfomen» in Schulpraxis und LehrerInnenbildung, Wien/Münster: LIT-Verlag, 2007, S.79–97[21.2.2013]; → MFV0406.pdf
- Springay, Stephanie; Freedman, Debra (Hg.): Curriculum and the Cultural Body, New York: Peter Lang, 2007
- Spivak, Gayatri Chakravorty: An Aesthetic Education in the Era of Globalization, Cambridge/London: Harvard University Press, 2012
- Spychiger, Maria: «Ein offenes Spiel: Lernen aus Fehlern und Entwicklung von Fehlerkultur», in: Caspary, Ralf (Hg.): Nur wer Fehler macht, kommt weiter. Wege zu einer neuen Lernkultur, Freiburg i. Br.: Herder, 2008, S.25–48
- Sternfeld, Nora: «Der Taxispielertrick. Vermittlung zwischen Selbstregulierung und Selbstermächtigung», in: schnittpunkt (Beatrice Jaschke, Nora Sternfeld) (Hg.): Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen, Wien: Turia und Kant, 2005, S.15–33
- Wulf, Christoph; Zirfas, Jörg (Hg.): Pädagogik des Performativen. Theorien, Methoden, Perspektiven, Weinheim: Beltz, 2007 [21.2.2013]; → MFV0407.pdf
- Berliner Senat, Projektfonds kulturelle Bildung [10.12.2012]
- Gruppe «Wenn es so weit ist», Wien [30.11.2012]
- Harvard University, Cambridge, Project Zero [30.11.2012]